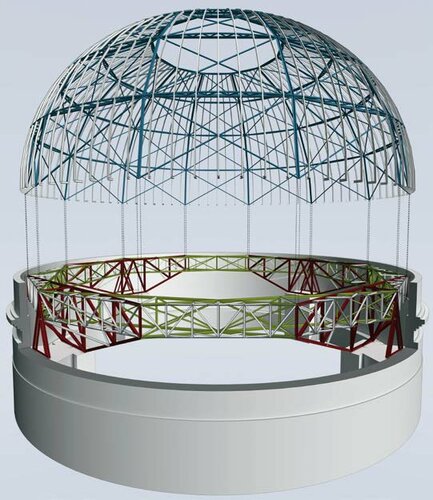Sie steht im Ruf, eine der coolsten Städte der Welt zu sein. Die große Metropole an der Spree steckt voller Sehenswürdigkeiten, atmet Geschichte an jeder Ecke und steckt voll kultureller Vielfalt. Tag für Tag bestimmen die Entscheidungen, die in der deutschen Hauptstadt getroffen werden, unseren Alltag, mehrere Millionen Menschen besuchen sie pro Jahr. Zahlreiche spektakuläre Bauten machen Berlin zu einem beliebten baukulturellen Schmelztiegel. Ein Ingenieurbauführer zeigt nun das Erbe von Generationen von Baumeistern und Bauingenieuren auf. Sie sorgten für das Funktionieren der Metropole, schufen die Tragwerke großartiger Architektur und häufig prägten ihre Werke das Gesicht der Stadt. Ihre weltweit beachteten Industriebauten, Kraftwerke und Gasanstalten, markanten Brücken, Tunnel und Bahnhöfe oder auch Stätten für Kultur, Sport und Vergnügen sind zu Meilensteinen der Bau- und Kulturgeschichte Berlins geworden. Reich bebildert und auch für den interessierten Laien verständlich, werden 111 Berliner Ingenieurwerke vorgestellt. Der Ingenieurbauführer von Werner Lorenz, Roland May und Hubert Staroste lädt ein, Berlin als Standort bedeutender Konstruktionskunst zu entdecken und ihre Spuren lesen zu lernen.
Die Gründung Groß-Berlins am 1. Oktober 1920 machte den atemberaubend expandierten Ballungsraum um Preußens Zentrum mit nun 3,8 Mio. Einwohnern nach London und New York zur drittgrößten Stadt der Welt. Längst war sie da bereits auch der größte und bedeutendste Industriestandort Kontinentaleuropas – angetrieben zunächst vom Maschinenbau, ab etwa 1880 dann vor allem anderen von den neuen Hochtechnologien der Elektroindustrie. Schon Firmen wie Borsig und Schwartzkopff hatten sich internationale Geltung erworben, mit Siemens und AEG wurde die Stadt zur weltweit einzigartigen „Elektropolis“. Das Gesicht der Metropole prägten nicht mehr nur die Prachtbauten des preußischen Klassizismus eines Karl Friedrich Schinkel, die historistischen Backsteingebäude seiner Schüler oder die kaiserzeitlichen Prunkarchitekturen in verschiedensten Eklektizismen, sondern nun auch ganz neuartige Industriebauten. Sie bereiteten den Weg zur Architektur der Moderne und fanden in der 1909 vollendeten AEG-Turbinenhalle ihren bis dahin höchsten Ausdruck. In der Katastrophe des Ersten Weltkriegs zerstob Preußens Glanz und Gloria. Die Jahre um die Gründung Groß-Berlins offenbarten im Elend der Hyperinflation einmal mehr auch das andere, dunkle Gesicht der Millionenstadt. Doch gerade aus dieser Not erwuchs in den 1920er-Jahren eine vielschichtige neue und soziale Architektur bis hin zu jenen Großsiedlungen der Moderne, die heute – neben Preußens Schlössern und Gärten sowie der Museumsinsel – als Weltkulturerbe geadelt sind.
Not und Mangel als Keimzellen einer neuen Baukunst – die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg schrieben diese Geschichte in Ost wie West der geteilten Stadt fort. Heute gilt das wiedervereinigte Berlin nicht zuletzt wegen seiner Risse und Brüche als ein besonders spannendes Kondensat der Architekturgeschichte.
Theorie und Praxis renommierter Bauschaffender
Schon im 19. Jahrhundert war diese Stadt wie wohl keine andere in Deutschland auch zu einer Metropole ingeniöser Baukultur herangewachsen. Gemessen an Städten wie London, Paris oder St. Petersburg waren die Anfänge in den ersten Jahrzehnten noch bescheiden gewesen. Dies änderte sich jedoch spätestens mit Johann Wilhelm Schwedler, dem wohl bedeutendsten preußischen Bauingenieur des 19. Jahrhunderts. In der ihm eigenen kompetenten Verschränkung von Baupraxis und ingenieurwissenschaftlicher Theorie vermochte er ab der Jahrhundertmitte erstmals auch international stark beachtete Akzente einer neuen Ingenieurbaukunst zu setzen. Gegen Ende des Jahrhunderts entwickelte sich dann an der 1879 gegründeten Königlich Technischen Hochschule zu Berlin unter Heinrich Müller-Breslau eine eigene technikwissenschaftliche Schule, die bald schon weltweites Renommee genoss: die Berliner Schule der Baustatik. Sie begründete etwa das Kraftgrößenverfahren als eine noch heute jeder Bauingenieurin und jedem Bauingenieur vertraute Methode zur wirklichkeitsnahen Berechnung auch komplexer Strukturen.
Das Besondere an diesem originär wissenschaftlichen Kompetenzzentrum aber lag in seiner engen Verbindung zur Praxis des Bauens: Müller-Breslau und seine Schüler waren zumeist Wissenschaftler und Beratende Ingenieure. Die Reihe der gerade deshalb weltweit bekannten Berliner Namen des konstruktiven Ingenieurbaus sollte sich bis zu Franz Dischinger als einem der international renommiertesten deutschen Bauingenieure des 20. Jahrhunderts fortsetzen. Sie wäre noch länger, wären in den 1930er-Jahren nicht exzellente Wissenschaftler wie etwa Hans Jakob Reissner ins Exil getrieben worden.
Konstruktionskunst und Architektur im Zeichen der Moderne
Gerade die Namen von jüdischen Bauingenieuren nämlich standen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu einem Großteil auch für ein zweites Charakteristikum der berliner Ingenieurbaukultur: die enge Vernetzung von Konstruktionskunst und Architektur im Zeichen der Moderne. Das Büro des gebürtigen Ungarn Ferenc Domány etwa arbeitete mit Peter Behrens und Erich Mendelssohn zusammen; Viktor Kuhn und Iţic Haber-Schaim zeichneten für architektonisch und technisch hochinnovative Bauten wie das Siemens-Schaltwerk-Hochhaus oder das Kraftwerk Klingenberg verantwortlich. Weitere Persönlichkeiten ließen sich nennen, insbesondere natürlich Karl Bernhard, einer der prägnantesten praktisch tätigen Bauingenieure der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Wie kein anderer in jener Zeit forderte er die Kompetenz des Ingenieurs auch als Gestalter ein und unterstrich dies selbst in seinem umfangreichen Oeuvre – von zahlreichen Brückenbauten über die AEG-Turbinenhalle bis hin zu ersten Stockwerksrahmen der 1920er-Jahre. Es gehört zu den dunklen Seiten der Erzählung von der Ingenieurbaukultur Berlins, dass viele dieser glänzenden Lebenswege im besseren Fall im Exil, nicht selten aber in Freitod oder Vernichtungslager endeten und dass die Namen der jüdischen Kollegen heute fast vollständig aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen sind.
Bauen in der Konkurrenz der Systeme
Und noch etwas machte die Baukultur der Ingenieure hier tatsächlich einzigartig in der Welt: die Teilung nach 1945 und die daraus resultierende Entwicklung zweier bei aller Verwandtschaft doch deutlich anders akzentuierter Praktiken des Ingenieurseins. Dem jeweiligen politisch-gesellschaftlichen System geschuldet arbeiteten die Bauingenieure auf der einen Seite der Mauer in eher noch kleinen spezialisierten Konstruktionsbüros oder aber den Planungsabteilungen von Baufirmen und Bauverwaltung, auf der anderen hingegen in großen „volkseigenen“ Kollektiven, in denen nicht nur Konstruktion und Architektur, sondern auch Planung und Produktion zusammengebunden waren. Hier war fast alles auf das Zukunftsversprechen industrialisierter Systembauweisen ausgerichtet, dort gab es ungeachtet aller Ökonomie und Normung doch nach wie vor viele individuelle Freiräume. Die einen verwalteten den Mangel, die anderen, gerade in den „fetten“ West-Berliner Jahren, den Überfluss. Die Systemkonkurrenz befeuerte spannende Baumaßnahmen auf beiden Seiten – von Interbau, Kongresshalle und ICC im Westen bis hin zur radikalen Neugestaltung des alten Zentrums im Berliner Osten mit Ahornblatt, Palast der Republik, Interhotel Berlin und vor und über allem dem Fernsehturm.
Wegbereiter urbaner Infrastruktur
Als weltweit gar richtungsweisend erwies sich die Kunst der Bauingenieure Berlins schließlich in Aufgabenfeldern, die jenseits des konstruktiven Ingenieurbaus angesiedelt, aber für die Entwicklung jeder modernen Großstadt von elementarer Bedeutung waren und sind. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Berlin zum Vorreiter einer modernen Wasserinfrastruktur. Es waren (zunächst vor allem englische) Ingenieure, die hier ab 1852 erstmals ein zentrales Frischwasser-Versorgungsnetz realisierten; das dritte zugehörige Wasserwerk in Friedrichshagen am Müggelsee galt zu seiner Zeit als leistungsfähigste Anlage Europas. Und es war der Berliner Bauingenieur James Hobrecht, der 1871 mit dem „Hobrecht-Plan“ ein Konzept für die Abwasser- und Fäkalienentsorgung vorlegte, das in den folgenden drei Jahrzehnten durch einen beispiellosen finanziellen Kraftakt der Kommune umgesetzt wurde. Nicht nur vielen Städten Deutschlands, sondern auch Metropolen wie Moskau, Kairo oder Tokio, galt Hobrechts Plan fortan als Blaupause für den Bau ihrer eigenen Kanalisationssysteme. Weitere Bereiche der städtischen Infrastruktur ließen sich nennen – bis hin zum Berliner Nahverkehrsnetz aus Hoch-, Untergrund- und Schnellbahnen, das mit der Elektrifizierung auch der S-Bahn in 1920er-Jahren als eines der besten der Welt gerühmt wurde.
Ein Ingenieurbauführer für Berlin
Es ist offensichtlich: Berlin kann und muss auch über Deutschlands Grenzen hinaus als einer der bedeutendsten Orte spannenden und hochwertigen Ingenieurbaus gelten. Und doch ist es hierfür kaum bekannt und noch weniger kommuniziert. Der kaum überschaubaren Vielzahl von Führern zu Architektur und industriellem Erbe stand bislang kein einziger gegenüber, der sich die zwar verwandte, aber doch ganz eigene Baukultur der Ingenieure in Berlin auf die Fahnen geschrieben hätte. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Fraglos entzieht sich vieles in der Arbeit des Ingenieurs für den Laien einer direkten Anschaulichkeit. Zudem heißt es oft, die Sprache des Ingenieurs sei die Zeichnung: Vielleicht mag die in diesem Euphemismus wohlwollend verpackte, vielzitierte Sprachlosigkeit der Nachkriegs-Bauingenieure ein weiterer Grund sein. Und eventuell ist das Erscheinen dieses ersten Ingenieurbauführers für Berlin ja Ausdruck des sen, dass sich genau daran allmählich etwas ändert. Wie auch immer, es war höchste Zeit.
Was ist „Ingenieurbau“?
Was verstehen die Verfasser unter „Ingenieurbauten“? Folgt man der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) oder der DIN 276 (Kosten im Bauwesen), dann stellt „Ingenieurbau“ die „Gesamtheit von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen“ dar. Der Begriff bezeichnet dort all das, für das Bauingenieurinnen und Bauingenieure originär die erste Verantwortung tragen – von Bauten und Anlagen des Wasserbaus, der Wasserver- und Abwasserentsorgung über Masten und Türme bis hin zu Verkehrseinrichtungen aller Art. Ausdrücklich ausgeschlossen sind alle Arten von „Gebäuden“ des Geschoss- und Hallenbaus, weil dafür in der Regel Architekten mit der „Objektplanung“ die primäre Verantwortung übernehmen.
Als Grundlage für einen Ingenieurbauführer wäre ein derartiges Verständnis jedoch fatal. Auch im klassischen Hochbau nehmen Bauingenieurinnen und Bauingenieure oft entscheidenden Einfluss, nicht nur hinsichtlich des Tragwerks, sondern auch der Fassaden, der Klimatisierung oder der Versorgungstechnik. In diesem Sinn werden deshalb hier unter „Ingenieurbau“ all jene baulichen Strukturen verstanden, die von Bauingenieurinnen und Bauingenieuren entweder eigenständig oder aber unter ihrer maßgeblichen Mitwirkung entwickelt, entworfen, bemessen und konstruiert wurden – Bauten also, bei denen etwa der Konzeption und Detaillierung des Tragwerks besondere Bedeutung zukommt, die sich durch technische Finessen in Konstruktion, Fassade, Klimatisierung etc. auszeichnen oder aber die tatsächlich dem großen Bereich der früher einmal als „Kunstbauten“ bezeichneten „Ingenieurbauwerke“ zugeordnet sind. Solcherart Ingenieurbau gibt es nicht erst, seit sich die Planer auch Ingenieure nannten. Ingenieurbauten und das zugehörige Ingenieurhandeln reichen schon Jahrtausende weit in Zeiten zurück, in denen es den Terminus „Ingenieur“ noch gar nicht gab. In eben diesem Sinn beginnt die Chronologie der von uns vorgestellten Ingenieurbauten bereits mit dem im 14. Jahrhundert mit hoher konstruktiver Kompetenz errichteten Dachstuhl der Spandauer Nikolaikirche.
Die Qual der Wahl
Schon hier freilich hätte man auch mit der Berliner Marienkirche beginnen können. Die unausweichliche Beschränkung erwies sich als eine der größten Herausforderungen des Projekts. Aus einer ersten Vorauswahl mit mehr als 500 Bauten haben die Autoren sich nach intensiven Diskussionen für 111 Objekte entschieden, die repräsentativ für die Entwicklung der von ihnen in zehn Kategorien unterteilten Berliner Ingenieurbaukunst stehen mögen. Unverzichtbare Bedingung war es, dass sie noch existieren. Im Übrigen aber haben sich die Verfasser um eine überzeugende und nachvollziehbare Auswahl bemüht – auch wenn sie sich gewiss sind, dass jedwede Auswahl unvollkommen und anfechtbar bleiben muss. Anregungen für Ergänzungen in einer künftigen zweiten Auflage nehmen sie daher gerne entgegen.
Die Zusammensetzung des Autorenkreises – ein historisch bewanderter Bauingenieur, ein grenzgängerischer Architekturhistoriker und ein technikaffiner Denkmalpfleger – bot dabei die Chance und die Verpflichtung zugleich, mit diesem Führer nicht etwa Trennlinien zu schärfen, sondern vielmehr verbindende Türen zu öffnen. Er ist so geschrieben, dass auch Nicht-Ingenieure Freude am Lesen haben sollen. In der Darstellung wurde jede unnütze Abgrenzung zu Architektur und Stadtplanung vermieden – im Einklang mit dem vielzitierten Bekenntnis Jörg Schlaichs: „Baukunst ist unteilbar.“ Nicht zuletzt galt es, den Ingenieuren hinter den Bauten ihren Namen zu geben und, wenn möglich, eben nicht nur die Büros und Firmen, sondern auch die verantwortlich mit dem jeweiligen Bauwerk befassten Planer zu benennen. Dass es fast ausschließlich Männer waren und sind, möge man nachsehen – der Lauf des Vergangenen lässt sich nicht ändern.
Die Wertschätzung des eigenen Erbes als Herausforderung
Jenseits aller hehren Worte freilich ist die alltagspraktische Ignoranz mancher Bauschaffenden gegenüber den Zeugnissen der eigenen Geschichte bemerkenswert. Dass für sie die geschichtliche oder kulturelle Besonderheit, die städtebauliche Dimension oder auch die gestalterische Qualität eines Brückendenkmals allenfalls nachrangig von Bedeutung sind, mag noch als verständlich erscheinen. Was aber wirklich verwundert: Es gab und gibt in der Regel auch keine erkennbare Identifikation mit dem technischen Denkmal als Erbe des eigenen Berufsstands, das zu erhalten ein Wert wäre – eine facheigene Wertschätzung, die sich aus so etwas wie dem Stolz auf die eigenen Vorgänger speist. Vielleicht vermag dieser Ingenieurbauführer ja ein wenig dazu beizutragen, die Kluft zwischen Sonntagsrede und alltäglicher Praxis zumindest bewusst werden zu lassen.
Achtung vor dem Bestand ist mehr als eine kulturelle Entscheidung
Dies vor allem auch deshalb, weil die Kunst der Reparatur zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine ganz neue Aktualität erhalten hat. 2020 fiel der Earth Overshoot Day auf den 22. August. Den Modellen des Club of Rome zufolge hatte die Menschheit an diesem „Erdüberlastungstag“ alle über das Gesamtjahr weltweit erneuerbaren Ressourcen bereits verbraucht; vom 23. August an lebte und lebt sie für den Rest des Jahres über ihre Verhältnisse. Grundlage der entsprechenden Berechnungen ist das Konzept des ökologischen Fußabdrucks:Man vergleicht das, was der Erde entnommen wird, mit dem, was sie regenerieren kann. Am 22. August war der Faktor 1 erreicht. Vice versabräuchte die Weltbevölkerung zurzeit rechnerisch 1,6 Erden, um ihren Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken. Würden alle so leben wie wir hier in Deutschland, bedürfte es gar dreier Planeten.
Erstaunlicherweise ist der Anteil der Bauproduktion an dieser zukunftsverweigernden Ausbeutung in der öffentlichen Diskussion nach wie vor kaum ein Thema.
Beängstigend ist dabei die ungebremste Beschleunigung des Verbrauchs. Im gesamten20. Jahrhundert wurden in den USA 4,5 Milliarden Tonnen Beton verbaut – in China waren es allein in den drei Jahren von 2011 bis 2013 6,6 Milliarden. Selbst der dafür benötigte Sand ist längst zu einem Ressourcenproblem geworden. Sand ist nicht gleich Sand, Wüstensand etwa ist zu feinkörnig und zu rund, als dass sich daraus Beton herstellen ließe. Konservativen Schätzungen zufolge baut die Menschheit jährlich doppelt soviel nutzbaren Sand ab, wie alle Flüsse der Welt nachliefern. Der Sandabbau ist zu einem weltweiten Milliardengeschäft mit teils mafiösen Strukturen und oft gravierenden Kollateralschäden für die Umwelt geworden. Die Ressourcenbilanz mag im Stahlbetonbau besonders verstörend sein, doch der Fußabdruck anderer Bauweisen – verbunden mit etwa der Stahloder Aluminiumproduktion – steht dem nur begrenzt nach.
All das ist im Grundsatz bekannt, doch es zeitigt bisher kaum ernsthafte Konsequenzen. Nahezu absurd mutet es an, dass der ins Gigantische angewachsene europäische Normungsapparat heute bis ins letzte Detail die Zulassung und Verwendung jeder Schraube vorschreibt, aber zu derart essentiellen Fragen schweigt. Bestens geregelt wird der Planet immer schneller und rücksichtsloser ausgeschlachtet, ohne dass den Vorschriften nennenswerte Grenzen setzen würden. Ein mal angenommen, das Bauen sei im gegenwärtigen Maße überhaupt erforderlich, gibt es eigentlich nur zwei Wege, um dem ungebremsten Ressourcenfraß Einhalt zu gebieten. Die eine Möglichkeit ist, im Neubau weniger und weniger neues Material zu verbrauchen. Die andere liegt darin, sich auf das zu besinnen, was schon da ist, und es kontinuierlich an veränderte Erfordernisse anzupassen, also: reparieren, instandsetzen, behutsam weiterbauen.
„Wir brauchen eine neue Kultur des Pflegens und Reparierens“
Im theoretischen Diskurs über das Bauen der Zukunft ist die Einsicht in das ökologische Potenzial von Reparatur und Weiterbauen fast schon zum Mainstream geworden. Werden auch wir Bauingenieure allmählich anders denken lernen können? „Civil engineering is the art of working with the great sources of nature for the use and benefit of society” – so lautet der 2004 aktualisierte Leitsatz der britischen Institution of Civil Engineers (ICE). Er fordert von den Bauingenieuren des 21. Jahrhunderts mehr als den regelkonformen Nachweis der statischen Verlässlichkeit. „For the use and benefit of society“: Nimmt man dies ernst, verlangt es nicht weniger als die bewusste Abwägung unterschiedlicher gesellschaftlicher Zielvorstellungen und die ingeniöse Entwicklung im besten Sinne „ganzheitlicher“ Lösungen. Selbst wenn also vielen Bauingenieurinnen und Bauingenieuren im Umgang mit dem Bestand die Wertschätzung des geschichtlichen Bedeutungswerts auch weiterhin als allenfalls nachgeordnete Kategorie gelten mag – spätestens die nüchterne, Ingenieurwesensvon Zahlen unterlegte Ressourcenbilanz des bewahrenden Weiterbauens lässt sich nicht mehr ignorieren. Weiterbauen statt neu bauen – das ist ein Paradigmenwechsel. Es ist höchste Zeit, mehr darüber nachzudenken, wie sich das Bewusstsein dafür auch in der Praxis des Ingenieuralltags befördern und etablieren ließe.
Es wäre vermessen, von einem Buch zu erwarten, dass es die Welt verändert. Aber vielleicht setzten wir Ingenieurinnen und Ingenieure in noch besserer Kenntnis unserer großartigen Tradition unser ganzes Streben daran, für die großen Herausforderungen des Bauens im 21. Jahrhundert nicht nur bislang ungedachte, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Vielleicht wagen wir es auch, unser eigenes Erbe und die Kunst der Reparatur immer mehr schätzen und mit Kenntnis, Kompetenz und Kreativität pflegen zu lernen.