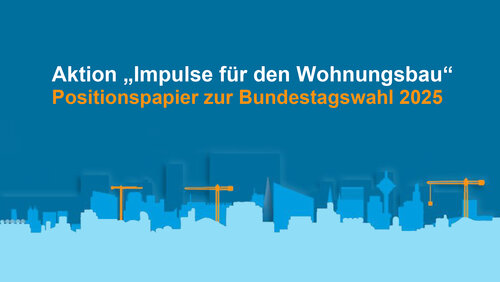Die folgende Zusammenstellung kann nur einen kurzen Überblick bieten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die vollständigen Wahlprogramme der Parteien sind auf deren jeweiligen Internetseiten zu finden sowie gesammelt z. B. bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.
Die Reihenfolge der Parteien in dieser thematischen Auflistung entspricht der aktuellen Sitzverteilung im Deutschen Bundestag und ist mit keiner Wertung verbunden.
Wohnungsbau
Die SPD will Bürokratie abbauen, um den Wohnungsbau zu beschleunigen. Die Investitionen in den sozialen Wohnungsbau sollen auf hohem Niveau gestärkt und verstetigt werden. Vorgesehen ist, über den sogenannten „Deutschlandfonds“ Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften mit dem nötigen Eigenkapital zu versorgen. Einheimischenmodelle und Konzeptvergaben sollen bei der Vergabe von Bauland gestärkt werden. Die Mietpreisbremse wird als gutes Instrument zur Eindämmung steigender Mieten gesehen, sie soll daher verlängert werden. Zudem will die SPD eine bundeseigene Wohnungsgesellschaft zur Entlastung des Marktes installieren.
Die CDU/CSU will bürokratische Hürden beim Wohnungsbau beseitigen, z. B. durch befristete Sonderregeln für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten. Sie möchte zudem ein „Baukostenmoratorium“ erlassen, d. h. es soll keine neuen Standards geben, die Baukosten ohne nennenswerten Mehrwert erhöhen. Den Gebäudetyp E will sie weiter voranbringen. Die Senkung von Planungs- und Nebenkosten soll durch Digitalisierung und Beschleunigung von Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren ermöglicht werden. Mehr Bauen sorge für günstigere Mieten. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben soll zur Schaffung von Wohnraum bundeseigene Grundstücke zur Verfügung stellen.
Bündnis 90/Die Grünen wollen die Mietpreisbremse verlängern und ausweiten. Beim Neubau setzt die Partei verstärkt auf Bauen im Bestand in Form einer Förderung von Umwandlung von Büro- zu Wohnraum, Dachaufstockungen und Reaktivierung leerstehender Gebäude. Daneben möchte sie eine Wohnungsbauprämie einführen, deren Höhe mit der Inflation steigt und die eine klare Klimakomponente beinhaltet.
Die FDP will Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen – etwa durch Abschaffung überflüssiger Umweltgutachten – und steuerliche Abschreibungen erleichtern, um den Wohnungsbau zu fördern. Der „Gebäudetyp E“ soll die Blaupause für die Entrümplung des Baurechts werden. Zudem setzt sie darauf, Innovationen im Bauwesen und private Investitionen zu fördern. Nachverdichtung und Aufstockungen sollen künftig einfacher möglich werden, das serielle Bauen soll weiter vorangebracht werden. Die Mietpreisbremse wird abgeschafft, das Nebenkostenrecht soll vereinfacht werden.
Die AfD will mehr Mieter zu Eigentümern machen, u. a. durch Abschaffung der Grunderwerbssteuer für selbstgenutzte Immobilien und spricht sich für eine Bevorzugung von Genossenschaften bei der Beschaffung von Bauland aus. Bei der Vergabe von Grundstücken und Wohnraum sollen Einheimische bevorzugt werden. Mietenregulierung jeder Art erteilt die AfD in ihrem Wahlprogramm eine Absage – einkommensschwache Mieter sollen dagegen mit mehr Wohngeld unterstützt werden.
Die Linke plant eine Investitionsoffensive in Höhe von 20 Milliarden für gemeinnützigen Wohnraum – wenn Neubau, dann nur bezahlbarer Wohnraum. Dafür soll die Schuldenbremse abgeschafft werden. Sie fordert außerdem einen bundesweit geltenden Mietendeckel, da die Mietpreisbremse nicht ausreiche.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) setzt sich dafür ein, dass Wohnen am Gemeinwohl und nicht an Profitinteressen ausgerichtet wird. Die Grunderwerbssteuer soll beim Kauf des ersten selbstgenutzten Eigenheims entfallen. Die kommunale Selbstverwaltung muss gestärkt werden, damit lokalen Besonderheiten besser begegnet werden kann. Importabhängigkeiten müssen verringert werden, zudem wird eine Steuerbelastungsmoratorium gefordert, um den Wohnungsbau zu fördern. Investitionen in den Wohnungsbau sollen nicht der Schuldenbremse unterfallen.
Infrastruktur/Verkehr
Die SPD möchte einen Bundesmobilitätsplan auf den Weg bringen. Das Autobahnnetz soll umfassend saniert und ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen eingeführt werden. Auch Schienen und Wasserwege sollen wieder „fit“ gemacht werden – für die Schiene und den Ausbau eines leistungsfähigen Schienennetzes plant sie Rekordinvestitionen. E-Autos sollen massiv gefördert werden genauso wie der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Um die notwendigen Investitionen zu ermöglichen, soll ein Deutschlandfonds eingerichtet werden, der öffentliches und privates Kapital mobilisiert, um die wichtigen Investitionsbedarfe erfüllen zu können.
Die CDU/CSU will den EU-Beschluss – „Verbrenner-Aus“ bis 2035 – rückgängig machen, den Ausbau der Ladeinfrastruktur aber weiter voranbringen. Die Infrastruktur müsse solide ausfinanziert und eine dauerhafte Finanzierungsstabilität unabhängig von schwankenden Haushaltsmitteln erreicht werden, z. B. mit Hilfe privater Investoren. Großprojekte bedürfen der Priorisierung, Infrastrukturvorhaben sollen generell beschleunigt und vereinfacht, z.B. Ersatzneubauten durch ein einfaches Anzeigeverfahren, zugelassen werden. Die Bahn müsse gestärkt werden, dazu gehöre eine Verschlankung der Strukturen und eine Neuaufstellung.
Bündnis 90/Die Grünen stehen zum EU-Beschluss des Verkaufsverbots für Benziner und Diesel. Sie wollen einen Bundesmobilitätsplan erstellen, der Basis für eine klimaneutrale und flächenschonende Mobilität bis 2045 ist. Davon umfasst ist auch der Ausbau von Radschnellwegen und ein Sicherheitstempo von 130 km/h auf Autobahnen, wie in anderen europäischen Ländern. Mit einem sogenannten „Deutschlandfonds“ wollen sie dem „Investitionsstau im dreistelligen Milliardenbereich“ begegnen. Er soll Bund, Länder und Kommunen im Bereich Infrastruktur unterstützen – keine laufenden Ausgaben decken. Die Schuldenbremse wollen die Grünen „sinnvoll modernisieren“.
Die FDP fordert „bezahlbare und nachhaltige Mobilität unabhängig von der Antriebsart“. Beim Ausbau der Infrastrukturen ist ihr Ziel, die Planungszeiten für alle Infrastrukturprojekte mindestens zu halbieren. Zur Finanzierung will die FDP den „Finanzierungskreislauf Straße“ stärken, eigene Einnahmen für die Autobahn GmbH durch die LKW-Maut und eine Öffnung für privates Kapital, um eine auskömmliche und überjährige Planung und Finanzierung zu ermöglichen.
Die AfD will das Verbrenner-Verkaufsverbot für Neuwagen wieder aufheben. Die Partei möchte insgesamt den „motorisierten Individualverkehr als beliebteste Möglichkeit der Fortbewegung“ fördern und die Bevorzugung von E-Mobilität stoppen. Sie fordert den Ausbau eines vernetzten Schienennetzes nach Schweizer Vorbild und die Überführung der Bahn in eine GmbH. Bei der Instandsetzung von Autobahnen und Brücken setzt die AfD auf effizientere Planungs- und Bauverfahren.
Die Linke ist für das EU-weite Verkaufsverbot von Verbrennern. Sie möchte den Umstieg auf E-Autos „für Handwerk, soziale Dienste, Taxibetriebe, Kleingewerbe und Menschen auf dem Land mit niedrigem Einkommen“ fördern und spricht sich für autofreie Innenstädte und eine konsequente Mobilitätswende aus. Die Linke ist für ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen. Für den Infrastrukturbereich will sie einen verkehrsträgerübergreifenden Investitionsfonds einrichten, die Deutsche Bahn müsse gemeinwohlorientierte „Bürgerbahn“ werden.
Das BSW stellt sich gegen eine „100%-Klimaneutral-Ideologie“ und „Autofeindlichkeit“, wie die Partei in ihrem Programm schreibt. E-Mobilität solle mit der Entwicklung günstiger Modelle unterstützt werden. Grundsätzlich müssen die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur insgesamt vorangetrieben werden, um den Investitionsstau zu lösen. Um dies zu finanzieren, soll die Schuldenbremse reformiert werden. In Innenstädten sollen Fahrradwege sicher und der ÖPNV attraktiv gestaltet werden.
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die SPD will das Wirtschaftswachstum durch höhere Geschwindigkeiten und weniger Bürokratie ankurbeln. Den Deutschlandpakt zur Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung möchte die SPD konsequent weiter voranbringen. Neue Gesetze müssen einem Praxischeck unterzogen und die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. An der Schuldenbremse solle grundsätzlich festgehalten werden, diese müsse aber bei Bedarf reformiert oder sogar ausgesetzt werden, um Investitionen in die Zukunftsfähigkeit zu ermöglichen. Im Kontext Arbeit und Soziales strebt die SPD eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 15 Euro an. Außerdem möchte sich die SPD für eine Stärkung der Forschungsförderung einsetzen, insbesondere in der Grundlagenforschung der Schlüsselindustrien und bei „GreenTech“.
CDU/CSU will mit einer „großen Steuerreform“, unter anderem einer niedrigeren Unternehmenssteuer und der Abschaffung des Solidaritätszuschlags, den Unternehmen unter die Arme greifen. Zudem soll es eine Vielzahl von Steuersenkungen geben, die Schuldenbremse aber erhalten bleiben. „Entrümpelungsgesetze“ sollen die Entbürokratisierung voranbringen. Gesetze und Regelungen müssen stärker befristet werden, der Mittelstand soll es bei Vergaben „einfacher“ haben, Betriebe sollen weniger dokumentieren und aufbewahren müssen. Deutschland solle ein Innovationsstandort für Zukunftstechnologien werden, z. B. für Luft- und Raumfahrt oder KI. Die Bauförderung soll neu ausgerichtet, Planungs- und Nebenkosten durch Digitalisierung und Beschleunigung gesenkt werden.
Bündnis 90/Die Grünen wollen unnötige Bürokratie (auch „Datenschutzbürokratie“) abbauen, ohne notwendige Standards im Umwelt- und Verbraucherschutzbereich zu streichen. Helfen soll hierbei ein „Praxischeck“. Das Vergaberecht soll umfassend modernisiert werden, eine auf fünf Jahre befristete Prämie von 10 Prozent soll Investitionen aus der Wirtschaft ankurbeln. Die Losvergabe muss die Regel bleiben, um KMU den direkten Zugang zu öffentlichen Aufträgen zu erhalten. Den „Green Deal“ der EU will die Partei um eine industrielle Dimension erweitern. Unternehmen, die besonders viel CO2 einsparen, sollen zusätzliche Förderungen erhalten.
Die FDP will Bürokratie abbauen und verlangt ein dreijähriges Moratorium – auch im Datenschutz. Eine Bürokratiebremse soll im Grundgesetz verankert werden. Das Vergaberecht soll entrümpelt, für Direktaufträge soll die Wertgrenze auf 100.000 Euro angehoben werden. Vergabefremde Kriterien, zum Beispiel soziale oder ökologische Aspekte, lehnen die Liberalen als Entscheidungskriterium ab. Unnötige Vorgaben aus der EU, wie etwa die Taxonomie oder die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, sollen abgeschafft werden. Im Kontext Planungsbeschleunigung sollen umfangreiche Genehmigungsfunktionen – etwa bei Bauanträgen – eingeführt werden.
Die AfD setzt sich für Deregulierung, niedrigere Steuern für Unternehmen und Bürger und die Abschaffung von Umweltauflagen ein und fordert eine Vereinfachung und Vereinheitlichung insbesondere des Baurechts sowie die Digitalisierung von Genehmigungsverfahren. Grundsätzlich soll die Reduktion bürokratischer Hürden und Normenabbau Investitionen beschleunigen helfen. Die Einkommenssteuer möchte sie mittels eines höheren Grundfreibetrages senken. Zudem spricht sich die AfD für eine Vereinfachung des Vergaberechts und die drastische Reduzierung von Vorschriften, Berichts- und Dokumentationspflichten für den Mittelstand aus.
Die Linke möchte eine Wirtschaftspolitik, die „Voraussetzungen für breiten gesellschaftlichen Wohlstand schafft“. Öffentliche Unternehmen sollen dabei zum Motor der industriellen Erneuerung werden, eine steuernde Rolle einnehmen und die Kompetenzen privater Unternehmen in Kooperationen einbinden. Nachjustieren will die Linke auch bei den Steuern, die gegenwärtig einem Flickenteppich glichen. Viele Gemeinden seien chronisch unterfinanziert. Sie schlägt daher bspw. eine Umwandlung der Gewerbesteuer in eine Gemeindewirtschaftsteuer vor. Die Bemessungsgrundlage solle dann ausgeweitet und auch gutverdienende Selbständige und Freiberufler einbezogen werden.
Für das BSW ist Bürokratieabbau der Schlüssel für Wachstum und Innovation – Ziel müsse es sein, unnötige Regeln, Auflagen und Prozesse abzuschaffen und Verfahren zu vereinfachen. Es soll einen „nationalen Tag der Entrümpelung“ geben, der halbjährlich Regeln und Vorschriften kritisch hinterfragt. Im Hinblick auf die EU soll die Übererfüllung von Standards, unter anderem bei ESG-Regeln, gestoppt werden. Steuerliche Entlastungen soll es für den Mittelstand und die „ärmere Bevölkerung“ geben. Finanziert werden soll das vor allem durch eine höhere Belastung Wohlhabender. Die Schuldenbremse sei zur „Investitionsbremse“ geworden, daher gehöre sie reformiert.
Energie/Klima
Die SPD spricht sich dafür aus, die Atomkraftwerke abgeschaltet zu lassen und bekennt sich zu den Klimazielen der EU. Für die SPD sind Windkraft und Photovoltaik die günstigsten Formen der Stromproduktion, weshalb sie deren konsequenten Ausbau und die Einbindung von Speichern anstrebt. Auch die Nutzung und Speicherung von Wasserstoff will sie massiv ausweiten. Die SPD spricht sich für eine Städtebauförderung zur Anpassung an den Klimawandel aus, um Städte zu einer grünen Infrastruktur zu verhelfen und hitzeresiliente Städteplanung umzusetzen. Kommunen sollen dafür durch Fördermittel und technische Unterstützung Anreize bekommen, ihre Wärmeversorgung klimaneutral zu gestalten.
Die CDU/CSU möchte eine technologieoffene bezahlbare Energie. Im Gebäudesektor setzt sie auf eine CO2-Bepreisung mit sozialem Ausgleich und einer verlässlichen Förderung. Die Anpassung an den Klimawandel werde immer wichtiger. Die Flächenversiegelung will sie reduzieren und Städte und Gemeinden beim verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und einer verstärkten Begrünung unterstützen. An der Klimaneutralität bis 2045 hält die CDU/CSU fest – unter der Prämisse des Erhalts der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und der sozialen Tragfähigkeit. Im Hinblick auf zunehmende Extremwetter-Ereignisse, spricht sie sich für eine „flächendeckende Pflichtversicherung für Elementarschäden“ aus.
Bündnis 90/Die Grünen wollen die Industrie bei der klimafreundlichen Modernisierung unterstützen. Dafür setzen sie auf einen Mix aus marktwirtschaftlichen Instrumenten wie dem CO2-Preis als zentralem Anreiz zur CO2-Einsparung, gezielter Unterstützung bei Investitionen und ggf. auf Klimaschutzverträge. Zur Nachfragesteigerung für klimaneutral hergestellte Produkte sollen grüne Leitmärkte in Sektoren wie Stahl und Zement etablieren werden, z. B. durch eine Mindestquote von grünem Stahl bei öffentlichen Aufträgen. Um Klimaschutz insgesamt „einfacher und bezahlbarer“ sollen Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen „einen Großteil der Einnahmen der CO2-Bepreisung von Gebäudewärme und Transport als Klimageld“ zurückbekommen.
Die FDP setzt auf den Bau neuer Gaskraftwerke, die Diversifizierung der Gasversorgung und Fracking in Deutschland. Subventionen für erneuerbare Energien will sie vollständig abschaffen. Außerdem will sie sichere Kernkraftwerke ermöglichen. Preis und Ausbau erneuerbarer Energien sollen zukünftig allein durch „den Markt“ reguliert werden. So werden nur Anlagen gebaut, die tatsächlich gebraucht werden. Das GEG soll nach dem Willen der FDP auslaufen, einen „Zwang zum Anschluss an Fernwärmenetze“ lehnt sie ab. Zu restriktive Regulierungen zur Nachhaltigkeit sollen reduziert, Umweltstandards auf die Minimumanforderung europäischer Gesetze zurückgeführt werden.
Die AfD spricht sich für eine Rückkehr zur Atomkraft und die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen aus. Die Laufzeiten von Kohlekraftwerken sollen verlängert, die CO2-Abgabe abgeschafft werden. Wind- und Solaranlagen sollen von der Zustimmung der Bevölkerung vor Ort abhängen. Der „Green Deal“ der EU wird abgelehnt, vielmehr setzt die AfD auf einen breiten Energiemix inklusive fossiler Energieträger. Anlagen zur Erzeugung „Erneuerbarer Energien“ müssen ihre uneingeschränkte Umweltverträglichkeit sowie ihren ökonomischen Nutzen durch den Verzicht auf Vorrangeinspeisung und Subvention nachweisen.
Die Linke hält am Atomausstieg fest, Deutschland soll zudem bis 2030 aus der Kohleenergie und bis 2035 aus der fossilen Erdgas-Energieproduktion aussteigen. Fracking lehnt sie ab. Klimaschutz und -anpassung muss als Gemeinschaftsaufgabe definiert werden, damit Bund, Länder und Kommunen gemeinsam handeln können. Staat und Kommunen sollen sich stark am Aufbau der erneuerbaren Energien beteiligen, z. B. mit einer Solarpflicht für Neubauten sowie für Bestandsbauten nach einer umfassenden Dachsanierung, wo es baulich möglich ist. Die Linke fordert eine Investitionsoffensive in energetische Sanierungen und Heizungstausch in Höhe von 25 Milliarden Euro pro Jahr.
Das BSW setzt auf Verhandlungen mit Russland, um die Versorgungssicherheit bei Gasimporten sicherzustellen. Die Energiewende kritisiert das BSW und verlangt eine technologieoffene Energiepolitik. Die Energienetze sollen zur Kostenreduktion in staatliche Hände überführt werden. Alte Windlagen sollen durch effizientere Modelle ersetzt und so der Stromertrag „ohne neue Eingriffe in die Natur“ gesteigert werden. Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen soll auf bereits versiegelten Flächen – öffentlichen Gebäuden, Parkplätzen Ställen und Werkshallen – gefördert werden. Großes Potential sieht das BSW auch in Fernwärme, Geothermie und der Abwärme industrieller Prozesse.
Bundestagswahl 2025
Auf ein Wort, liebe Ingenieurinnen und Ingenieure,
unsere am 23. Februar in den Bundestag gewählten Volksvertreter stehen vor gewichtigen Aufgaben für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Der enorme Investitions- und Handlungsbedarf für die Infrastruktur und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums gehören zu den wichtigsten Aufgaben einer neuen Regierung.
Bezahlbarer Wohnraum, Klimaanpassung und faire Vergabe
Planende Berufe mit gemeinsamen Forderungen zur Bundestagswahl 2025
Die Bundesarchitektenkammer und die Bundesingenieurkammer haben gemeinsam mit 16 Verbänden der planenden Berufe ihre „Forderungen zur Bundestagswahl 2025“ in 13 Punkten zu aktuellen Kernfragen gebündelt. Im Mittelpunkt stehen die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Umsetzung von integrierten Stadtentwicklungskonzepten, Ausbau und Sanierung von Infrastrukturen, die Finanzierung von Klimaanpassungsstrategien, eine faire und mittelstandsfreundliche Vergabe, die Überarbeitung des Architekten- und Ingenieurvertragsrechts und die Novellierung der HOAI.